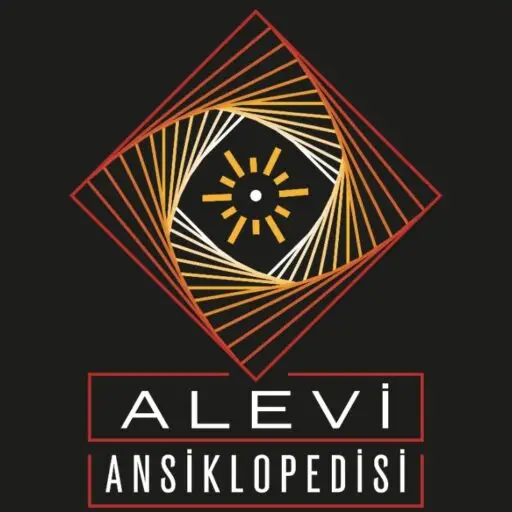Zazaki im Kontext des Alevitentums
* Dieser Eintrag wurde ursprünglich auf Türkisch verfasst.
Dieser Eintrag untersucht die Funktion des Zazaki (Kırmancki) innerhalb der alevitischen religiösen Welt, insbesondere mit Schwerpunkt auf Dersim. Zazaki spielt im Alevitentum eine zentrale Rolle nicht nur als Sprache ethnischer Identität, sondern auch als Träger ritueller und symbolischer Praktiken wie Cem-Zeremonien, Gülbenks, Erzählungen über heilige Orte sowie naturbezogene Kosmologien. Historisch mit dem Parthischen und anderen nordwestiranischen Sprachen verwandt, nimmt Zazaki eine Schlüsselstellung in der Weitergabe religiöser Vorstellungen und in der Bewahrung kollektiver Erinnerung ein. In den letzten Jahrzehnten ist diese Funktion jedoch durch zunehmende Assimilationsprozesse und Turkifizierung erheblich gefährdet worden.Sprache und ihre Sprecher/innen [1] [2]
Zazaki ist die Sprache von schätzungsweise 4 – 6 Millionen Menschen, die hauptsächlich im Osten Anatoliens, in den Anfangsläufen des Euphrat und Tigris beheimatet sind. Eine bedeutende Zahl der Sprecher findet sich vor allem in den Türkeimetropolen Istanbul, Ankara, Izmir und Mersin, des Weiteren noch in europäischen Ländern wie Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich und Schweden. Es ist wahrscheinlich die einzige Sprache, die nicht außerhalb der türkischen Landesgrenzen beheimatet ist.[3] Es ist nach dem Türkischen und Kurdischen die drittgrößte Sprache.
Geografisch zeigt sich das Zaza-Sprachgebiet relativ kompakt. Am häufigsten wird sie im Zentralgebiet von Dersim (Tunceli), Bingöl, Elazığ, im Osten Erzincans und Norden Diyarbakırs gesprochen. Im Gebiet des Ostens von Sivas, bekannt als Koçgiri und Karabel, wird in den Bezirken von Kangal, Zara, Ulaş, İmranlı, Divriği, Hafik und in (zu Tokat gehörend) Almus, in Kelkit und Şiran zu Gümüşhane, in Varto zu Muş, in Hınıs, Tekman, Çat und Aşkale zu Erzurum, in (zu Adıyaman gehörend) Gerger, in Siverek zu Urfa, in Pötürge und Arapkir zu Malatya, gesprochen. Des Weiteren befinden sich in den Enklaven von Baykan (Siirt), Mutki (Bitlis), Kozluk (Batman), Sarız (Kayseri), Aksaray, Ereğli (Konya), Derik (Mardin), Selim (Kars) und zu Ardahan gehörende Göle ebenfalls Zazas. Die benachbarten Sprachen dieser Siedlungsgebiete sind überwiegend Kurdisch[4] (Kurmancî) und Türkisch. Früher wurde im fast ganzen Sprachgebiet auch Armenisch, teilweise auch Syrisch (Neuaramäisch) gesprochen.
Religion
Die Zazas bestehen etwa zur Hälfte aus sunnitischen Moslems, die andere Hälfte aus Alevit/innen. In den Gebieten von Karabel (Sivas), Dersim, Erzincan, Nord-Bingöl, Varto, Hınıs, Tekman, Çat, Sarız, Göle und Selim gehören sie dem alevitischem Glauben, in den zentral und südlich gelegenen Gebieten dem sunnitischen Glauben an. Die sunnitischen Zazas aus den geografisch zentralen Gebieten Elazığ, Bingöl-Zentrum, Genç, Solhan, des Weiteren Hani, Kulp, Lice, Ergani, Dicle, Eğil, Silvan, Hazro zu Diyarbakır, sowie Mutki und Baykan gehören der schafiitischen, ein Teil von Maden zu Elazığ, die aus Çermik, Çüngüş, Gerger und Aksaray der hanafitischen Schule des Sunnitentums an. Besonders unter den alevitischen Zazas sind viele Elemente und Bräuche aus der Naturreligion und Kultur der Region wie der Wallfahrtsstätten- und Engelskult bewahrt und mit dem neuen Glauben vermischt und vom Schiitentum beeinflusst.
Die Stammestrukturen haben in den letzten Jahrzehnten ihre Bedeutung deutlich verloren. In Gerger befinden sich Zaza-sprachige assyrische und armenische Dörfer christlichen Glaubens, in Dersim sind auch vereinzelt armenischstämmige Familien anzutreffen. Ein rezentes Phänomen sind Zazas, die sich zum Schiitentum bekennen und zumeist aus den sunnitischen Gebieten stammen.[5]
Ethnizität und Ethnonyme
Wurden über das Zazaki bisher relativ gute Forschungen getätigt, lässt sich dasselbe über den ethnologischen Aspekt nicht sagen. Der Ethnologe Peter Alford Andrews gibt in seinem Buch Ethnic Groups in the Republic of Turkey (1989) die Zazas als eine eigenständige ethnische Gruppe unterteilt in alevitische und sunnitische Zazas an.
In vielen Quellen werden Zazas den Kurden[6], in einigen den Türken zugeordnet. Es gibt jedoch auch weitere Doktor- und andere Abschlussarbeiten sowie Artikel, in der die Zazas als eigenständige ethnische Gruppe angegeben werden:[7] Hüseyin Çağlayan (1995, 2020), Kahraman Gündüzkanat (1997), Krisztina Kehl-Bodrogi (1998), Kazım Aktaş (1999), Victoria Arakelova (1999), Selahattin Tahta (2002), Hülya Taşçı (2006), Gülsün Fırat (2010: 139), Yaşar Aratemür (2011, 2014), Eberhard Werner (2012, 2015, 2017, 2021), Esther Schulz-Goldstein (2013), Garry Trompf (2013), Zeynep Arslan (2016), Gohar Hakobyan (2017), Maria Philipp (2017), Rasim Bozbuğa (2019), Annika Törne (2020) und Mesut Asmên Keskin (2025).
Die Eigen- und Sprachbezeichnungen der Zazas variieren regional. Diese sind stärker konfessionell oder ethnisch als national geprägt. Bezeichnen sich die Sprecher in der Region Karabel generell als Zaza, ihre Sprache als Zazaki, so findet sich in der älteren Generation auch die Bezeichnung Ma “wir” und Zonē Ma “unsere Sprache”. In Dersim (im heutigen Sinne Tunceli, Mamekiye), Erzincan, Erzurum-Çat und Bingöl-Yayladere und ‑Yedisu bezeichnen sich die alevitischen Zazas als Kɨrmanj, ihre Sprache als Kɨrmanǰki – unter der älteren Generation ist auch Dɨmɨlki bekannt – die sunnitischen Zazas der Nachbargebiete bezeichnen sie als Zaza, die sunnitischen Kurden als Ḳur̄, die alevitischen Kurden als Kɨrdas(í), das Kurdische als Kɨrdaski[8] oder Hér̄e-wér̄e (Kurd. “geh-komm”). Die alevitischen Kurden in Dersim bezeichnen die alevitischen Zazas als Lacek (wörtl. “Junge”) oder Dêsiman “Dersimer”, ihre Sprache als Dêsimkî “Dersimisch”, Şo-bê (Zz. “geh-komm”) oder Dimilî. In den Gebieten Kiğı, Adaklı und Karlıova zu Bingöl, sowie Varto, Hınıs und Tekman hingegen bezeichnen sich die alevitschen Zazas als Šarē Ma “unser Volk” oder Elewi “Alevite”, ihre Sprache als Zonē Ma, ihre sunnitisch kurdischen Nachbarn hingegen (manchmal auch Sunniten generell) als Ḳurmanc ~ Kɨrmanj, die sunnitischen Zazas als Zaza oder Dɨlmɨǰ. Die sunnitischen Zazas Bingöls nennen die alevitischen hingegen als Doman (Nord-Zazaki “Kind”). In Varto/Hınıs bezeichnen die Kurden das Zazaki nach den Zaza-Stammesnamen Lolî oder Çarekî. Die Eigenbezeichnungen der alevitischen Zaza wären am besten mit “alevitischer Zaza” oder “Alevite” zu übersetzen, zudem auch die ältere Generation im Türkischen sich als Angehöriger des “alevitischen Volkes” angibt. Von politischen Bewegungen beeinflusste, insbesondere unter der jüngeren Generation existieren zum Teil polarisierte Identifizierungen wie “Zaza, Kurde, Türke, Alevite, Dersimer”. In Dersim und Erzincan wird die Bezeichnung Tɨrk primär für sunnitische Türken, sekundär auch für alle Sunniten gebraucht.[9]
Fast alle schafiitischen Zazas bezeichnen sich als Zaza und ihre Sprache als Zazaki, in den Gebieten Palu, Bingöl oder Dicle (Piran) existiert, wenn auch vereinzelt, parallel die Bezeichnung Kɨrd in Selbstreferenz, aber auch nur auf die Kurden (Kurmanc) bezogen, nicht beide einschließend. In Mutki und Baykan ist Dɨmɨli gängig. Sie bezeichnen ihre kurdischen Nachbarn als Kurmanǰ ~ Kuɨrmonǰ oder Kɨrdasi. Die Zazas der hanafitischen Schule bezeichnen sich überwiegend als Dɨmɨli, ortsweise auch als Zaza, ihre kurdischen Nachbarn als Kɨrdasi. Die hanafitischen Zazas in Aksaray nennen sich und ihre Sprache Kurdasí oder auch Zaza, die Kurden Qɨlorí. Die Kurden dort bezeichnen die Zazas als J̌aʿní (Ca’nî). Unter den Sunniten, besonders unter der Altersgrenze der 60-70-jährigen verwendet man das Ethnonym Zaza oder Dɨmɨli im ethnischen oder allgemein die Zazas umfassenden Sinne.
Die Stellung des Zazaki innerhalb den iranischen Sprachen
Das Zazaki ist innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie, dem indoiranischen Zweig angehörende iranische Sprachgruppe als eine nordwestiranische Sprache eingeordnet. Nach LeCoq und Gippert sind die iranischen Sprachen wie folgt klassifiziert:[10]NORDWESTIRANISCH:
Hyrkanische Gruppe: Balōči, Sangesari, Gorani, Zazaki
Karmanische Gruppe: Kurdisch, Sīvandī
Medo-Kaspische Gruppe: Gīlakī, Māzandarāni, Sorcheī, Semnāni, Tāleši, Āẕarī[11]
SÜDWESTIRANISCH:
Persisch, Tadschikisch, Tātī, Dialekte von Fārs
Die besonders in Deutschland getätigten Forschungen ermöglichen es, zu bestimmten Resultaten über die historische Stellung des Zazaki innerhalb der etwa vierzig Sprachen umfassenden neuiranischen Gruppe zu gelangen. Das schriftlich überlieferte Altindische (Veda und Sanskrit), das Avesta und Altpersische der altiranischen Ära, das Parthische, Mittelpersische und Soghdische der mitteliranischen Ära stützen dies als Sprachen mit reichem Korpus. Das Zazaki steht sprachhistorisch dem Parthischen (3. Jh. v. – 3. Jh. n. Chr.) nahe, besitzt einige archaische Aspekte.[12] Trotz einiger konservativer Eigenschaften kann es nicht direkt auf das Avestische als eine altiranische Sprache zurückgeführt werden. Die heutigen iranischen Sprachen waren vor etwa viertausend Jahren Dialekte des Uriranischen, zwischen denen möglicherweise auch Verständigung möglich war. Auch das Vedische als Altindische glich in der Grammatik über 80% dem Avestischen.
Sprachkontakt
Sprachgenetisch ist das Zazaki am nächsten unter den neuiranischen Sprachen mit dem zur hyrkanischen Gruppe Balōčī, Gorani, Sangesarī und dem kaspischen gehörende Gruppe Mazandarānī, Āẕari, Semnānī, Tālešī und Gīlakī verwandt. Die lauthistorische und morphologische Nähe zu den Sprachen verfestigt die Dailam-Theorie bzw. die Abstammung aus dem Norden Irans[13].
Im Lexikon wurde das Zazaki von den verwandten und direktem Kontakt stehenden Sprachen Kurdisch und Persisch beeinflusst. Nach der Islamisierungsperiode wurde der Wortschatz auch mit vielen Arabischen Lehnwörtern durchsetzt, durch die nachbarschaftlichen Beziehungen auch besonders durch das Armenische[14], wenn auch wenig, durch das Syrische beeinflusst. Außerdem finden sich begrenzt Lehnwörter aus dem Türkischen, Griechischen, Lateinischen, Georgischen und Lasischen.[15]
Forschungsstand
Auch wenn das Zazaki vor nicht allzu langer Zeit entdeckt und auch verschriftlicht wurde, wurde es in den letzten hundert Jahren relativ gut erforscht. In einigen osmanischen und armenischen Quellen wird die Existenz einer Zaza-Sprache erwähnt, die ersten Aufzeichnungen erfolgten jedoch erst in den Jahren 1857/58 durch den Iranisten Peter I. Lerch. In seinem Werk Forschungen über die Kurden und die Iranischen Nordchaldäer, welches über 40 Seiten Texte bzw. Einzelsätze mit deutscher Übersetzung enthält, gibt er einen ersten, für seine Zeit guten, sprachwissenschaftlichen Überblick über eine Mundart aus Bingöl, die er von einem osmanischen Kriegsgefangenen des Russisch-Osmanischen Krimkrieges aufgezeichnet hatte. Auch wenn Lerch, ohne den Grund dafür zu nennen, das Zazaki als kurdischen Dialekt annahm, fiel ihm bereits auf: “Das Zaza blieb dem Kurmancî bis auf einzelne Wörter unverständlich” (Bd. I, S. XXII). Einige Jahre danach widmete Friedrich Müller, basierend auf Lerchs gesammelten Texten, der historischen Lautlehre und Grammatik des Zazaki einen Aufsatz von 18 Seiten (1864). Etwa 40 Jahre danach erschienen zwei weitere Erzählungen von 5 Seiten sowie vier kurze Anekdoten und mehrere hundert Einzelsätze auf Zazaki, die der “Volontär einer Ausgrabungsexpedition” des deutschen Orientkomitees Albert von Le Coq zwei Jahre zuvor in Damaskus aufgezeichnet hatte (1903).[16]
Etwa zur selben Zeit (1906) sammelte Oskar Mann Texte in Ostanatolien, die die bis dahin umfangreichste Sammlung von Zazaki-Texten darstellen (einschl. deutscher Übersetzung ca. 91 S., 5 Mundarten) und von Hadank 1932 aus dem Nachlass Manns unter dem Titel Mundarten der Zâzâ – Hauptsächlich aus Siverek und Kor (Mann 1932) veröffentlicht wurden. Hadank schrieb als erster eine grammatikalische Beschreibung der einzelnen Mundarten, die “dem Leser das grammatikalische Verständnis der Texte … erleichtern” soll (S. VIII). Es ist es für damalige Verhältnisse und Forschungsstand eine unverzichtbare Quelle für die Dialektologie und die Erforschung des Zazaki. Es sei auch vermerkt, dass Oskar Mann und Karl Hadank 1909 als erste das Zazaki eine eigenständige Sprache nannten[17], und nicht wie bis dahin üblich einen kurdischen Dialekt. Die eigenständige Position des Zazaki wird bei Mann/Hadank (1932) auf den Seiten 18-23 durch einen Vergleich der Lautentwicklungen mit dem Kurdischen und anderen iranischen Sprachen dargestellt.
Über 50 Jahre später verfasste der amerikanische Linguist Terry Lynn Todd (1985) die erste nach Methoden der modernen Sprachwissenschaft verfasste Grammatik des Zazaki, A Grammar of Dimili (Also known as Zaza), das auf selbst gesammeltem Sprachmaterial aus Çermik beruht.
Besonders in den 90er Jahren wurden die linguistischen Forschungen über das Zazaki vertieft, es erschienen auch einzelne Aufsätze über Einzelthemen wie: [18] Phonologie (Cabolov 1985, Maurais 1978, Aratemür 2016), Negation (Sandonato 1994), Ezafeverbindungen (MacKenzie 1995), eine allgemeine gramm. Übersicht (Asatrian 1996, Asatrian/Gevorgian 1988, Asatrian/Vahman 1990, Blau 1989, Pirejko 1999, Kausen 2006 und 2012), Abhandlungen über die Stellung des Zazaki unter den iranischen Sprachen (Paul 1998b) sowie seine schriftliche (Selcan 1998b) und historische Entwicklung (Gippert 1996 und 2008), Etymologie (Bläsing 1995, 1997; Schwartz 2008; Aratemür 2011, 2012, 2013), Minderheitssprachen (Aratemür 2014), Rechtschreibung und Lesefibel (Jacobson 1993 und 1997), Codeswitching und Bilingualität (Temizbaş 1999, B. Werner 2006), Lehnwortadaption (Malottke 2007), Partikel (Arslan 2007), Dialektologie (Keskin 2008), Textanalyse (E. Werner 2013), Sprachverlust (Azbak 2013), Verbfunktionalität (Arslan 2016), Genus (Schirru 2017), Syntax und Semantik (2022) und Ezafe (B. Werner 2018, Çelik Dincer 2021), Klassifikationsfrage (Gholami 2022). Vier bedeutende Werke sind die Dissertationen von Ludwig Paul, Zülfü Selcan (beide 1998a), Ilyas Arslan (2016) und Yaşar Aretemür (2025). Pauls Werk besteht aus vier Teilen, von denen Teil I ausführlich die Grammatik des Dialekts von Siverek anhand des Idiolekts von Koyo Berz darstellt, Teil II als Versuch einer Dialektologie im Überblick eine Reihe anderer Dialekte beschreibt, Teil III zu den jeweils beschriebenen Dialekten und Mundarten eine oder mehrere Texte beinhaltet und Teil IV diesen Texten ein Wörterverzeichnis Zazaki-Deutsch, Deutsch-Zazaki zur Seite stellt. Selcans Grammatik der Zaza-Sprache gibt eine ausführliche Beschreibung (über 600 Seiten) der hauptsächlich in Dersim Zentrum (Tunceli) gesprochenen Mundart u.a. mit reichhaltigen Literaturangaben. Arslans Doktorarbeit Verbfunktionalität und Ergativität in der Zaza-Sprache beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Basistruktur der Verben im Zazaki und um eine detailliertere Untersuchung zum Ergativsystem.
Obwohl die Stellung des Zazaki in der Iranistik seit einem Jahrhundert insoweit begründet ist, existiert darüber besonders in türkischen Quellen, im Medium und der Politik -auch wenn im Gegensatz zu früher schwindend- ein Status quo. Es sind Ansichten, dass das Zazaki ein kurdischer Dialekt sei, die auf Vorurteilen, Wissens- und Quellenlücken oder politischen Motivationen und Bevormundungen beruhen. Jedoch ist dies bisher linguistisch nicht bewiesen. Die Nähe Zazakis zum Persischen und Kurdischen rührt nicht daher, weil es ein Dialekt oder Subgruppe dieser ist, sondern verwandte Sprachen innerhalb derselben Sprachgruppe sind. Dasselbe gilt auch für die Ansicht, dass das Kurdische ein Dialekt des Persischen sei. Wie auch Karl Hadank (1938: 5) zu Wort bringt, ist Persisch “… nur eine Sprache neben einer Anzahl anderer iranischer Sprachen, nicht etwa die Mutter aller.” Es ist bekannt, dass O. Mann, K. Hadank, D.N. MacKenzie, L. Paul auch Forschungen über das Kurdische betrieben haben.
Die Stellung und Bedeutung des Zazaki im Alevitentum
Zazaki tritt insbesondere innerhalb des in Dersim zentrierten Alevitentums nicht nur als Sprache einer ethnischen Zugehörigkeit, sondern ebenso als Sprache einer Glaubenswelt hervor. Wesentliche Elemente wie Rituale, Cem-Zeremonien, nefes (religiöse Gesänge), Segens- und Fluchformeln, Legenden über heilige Stätten, der Wallfahrtskult sowie naturreligiöse Glaubensvorstellungen sind in erheblichem Maße über diese Sprache vermittelt und haben durch sie ihre Bedeutung erhalten.
Während Zazaki einerseits als Sprache, die historisch immer wieder Repressionen ausgesetzt und weitgehend aus der Schriftkultur ausgeschlossen war, um ihre Identität zu bewahren rang, fungierte sie andererseits als Trägerin lebendiger ritueller Praktiken und kollektiver Erinnerung in ihrer Funktion als Glaubenssprache. Selbstbezeichnungen wie “Raa ma” (unser Weg) oder “İtıqatê ma” (unser Glaube) verdeutlichen, dass Zazaki nicht lediglich Kommunikationsmittel, sondern zugleich sprachliche Form einer religiösen Identität ist.
Die AlevitInnen in Dersim zeichnen sich durch das Vorhandensein zahlreicher ocaks (geistlicher Stämme) wie Babamansur (Bamasur), Kureyş (Khurêş), Dervişcemal (Dewrêş Cemal), Derviş Beyaz (Dewrêş Gewr), Ağuçan oder Sarısaltık aus, was die besondere Bedeutung der Region für das Alevitentum unterstreicht. Während AlevitInnen innerhalb vieler ethnischer Gruppen – Türken, Kurden, Araber, Roma, (alevisierte) Armenier sowie albanische Bektaschiten – eine Minderheit darstellen, bilden sie unter den Zazas die einzige Gruppe, die nicht in der Minderheit ist: Rund die Hälfte der Zazaki-SprecherInnen ist alevitisch, die andere Hälfte sunnitisch. Es wird angenommen, dass ein erheblicher Teil der sunnitischen Zazaki-SprecherInnen insbesondere nach der Schlacht von Çaldıran gezwungen war, vom Alevitentum zum Sunnitentum überzutreten. Die vorwiegend gebirgige Siedlungsweise der Zazas führte dazu, dass Glaubensunterschiede zugleich ein zentrales Kriterium für die dialektologische Gliederung des Zazaki wurden. So unterscheidet sich das von AlevitInnen gesprochene Nord-Zazaki von den anderen Hauptdialekten und bewahrt gleichzeitig seine innere Geschlossenheit.
Zazaki nimmt eine zentrale Rolle in den Gülbenks (Segenssprüchen), den Erzählungen über heilige Personen, den Legenden um Pilgerorte sowie in Glaubenssystemen über Natur und Engelwesen ein. Wie in den Sammlungen von M. Comerd dokumentiert, werden die Mehrzahl der Erzählungen über heilige Stätten und religiöse Formeln auf Zazaki tradiert. In Regionen wie Erzincan, Hınıs, Tekman oder Varto wird Zazaki als “Alevice” (Trk. “alevitisch” oder “Hızır Dili” (wie auch bei Sey Qaji belegt: “Zonê Ma Zonê Xızırio” – “unsere Sprache ist die Sprache Hızırs”) bezeichnet; in Muş wiederum entspricht das kurdische Exonym “Qizilbaşkî” derselben Zuschreibung. All dies belegt, dass Zazaki im Alevitentum eine konstitutive Stellung innehat und für die es sprechenden AlevitInnen besondere Bedeutung trägt.
Die Sprache fungiert im Rahmen religiöser Praxis als Medium für die Anrufung des Göttlichen (veng’a Heqi daene), für Gülbenks (gulbangi), für Gebete an Sonne (roc, tici) und Mond (aşme ~ asme), für Segenssprüche im Zusammenhang mit Pilgerstätten (ziyari ~ jiyari; ziyar u diyari) sowie für die im Cem erlebte ekstatische Erfahrung (tewt). Auch die Unterscheidung zwischen guten und bösen Engeln (bzw. Elfen und Kobolden) (mılaketê xêri, mılaketê xırabıni) sowie die Beschreibungen der “Wächter” heiliger Stätten, der Familie (wayirê çêyi ~ kêyi) und des Viehs (wayirê mali) sowie der Bergziegen (Şarık Şıvan, Memıko Gavan) unterscheiden sich inhaltlich deutlich von türkischsprachigen Alevi-Praktiken. In den Zazaki-Gebeten stehen insbesondere lokale Heilige und Stätten wie Duzgın, charismatische Persönlichkeiten mit spiritueller Kraft sowie Xızır im Vordergrund. Dagegen finden sich die unter dem Einfluss des Schiitentums in türkischsprachigen Alevitentümern verbreiteten Motive der Zwölf Imame oder Muhammads in den ältesten Zazaki-Gebeten kaum.[19] Unter dem Einfluss des Sufismus entwickelte sich eine esoterische Deutung, in der sich Motive wie Heq/Haq (“Gott”), Eli/Ali/Oli (“Gott, Ali”), Mehemed (“Sonne”) und Roştia Ana Fatma (“Mondlicht der heiligen Mutter Fatma”) überlagerten und ineinander verwoben, ohne dass deren historisch-dogmatischer Kontext oder ihre biographische Dimension der schiitisch-islamischen Heiligen und ihrer religiösen Praktikten im Bewusstsein präsent gewesen wäre.
Im 20. Jahrhundert führten der zunehmende Einfluss des Türkischen auf die alevitische Ritualpraxis sowie die verstärkten Außenkontakte der Zaza-AlevitInnen dazu, dass in die ursprünglich auf Zazaki gesprochenen Gebete immer häufiger türkische Elemente – etwa Besen-, Tisch- und Schlafgebete oder die Bittgebete in der musahiplik (geistige Brüderschaft)-Zeremonie (ca vatene) – Eingang fanden. Parallel dazu gerieten traditionelle Zazaki-Gebete zunehmend in Vergessenheit.
Der alevitische Glaube in Dersim ist sowohl auf der Ebene symbolischer Vorstellungen als auch der rituellen Praxis zutiefst mit der Sprache Zazaki verwoben. Diese fungiert als Trägerin des Glaubens und Sinnstifterin religiöser Praxis. Figuren wie Duzgın, Xızır oder die Schlange, Erzählungen um heilige Stätten und volkstümliche Legenden verdeutlichen die zentrale Rolle des Zazaki im religiös-kulturellen System. Sie zeigen, dass Zazaki nicht nur Kommunikationsmittel, sondern Grundpfeiler der Tradierung des Glaubens, der Definition von Zugehörigkeit und der rituellen Kontinuität ist.
Die Assimilationspolitik der letzten achtzig Jahre sowie die nahezu ausschließlich türkischsprachige Vereinstätigkeiten der AlevitInnen seit den 1990er Jahren haben dazu geführt, dass die jüngeren, überwiegend türkischsprachigen Generationen sich zunehmend von der Glaubenssprache Zazaki entfremden.
Zazaki ist somit nicht allein die Sprache einer ethnischen Identität, sondern ebenso die Sprache einer alevitischen Glaubenswelt. Trotz historischer Unterdrückung und Assimilation behauptete sie ihren Platz als Ritualsprache insbesondere in den alevitischen Gemeinschaften des zentralen und peripheren Dersims. Von den Gülbenks bis zum Pilgern erhielten viele Praktiken ihre Bedeutung durch das Zazaki, wodurch es zu einem Medium des Heiligen und kollektiver Erinnerung wurde. Der in den letzten Jahrzehnten beschleunigte Sprachverlust bedroht jedoch die religiöse Funktion des Zazaki innerhalb des Alevitentums. Dies macht neue Initiativen zur Bewahrung und Revitalisierung der Sprache sowohl aus religiöser als auch aus kultureller Perspektive dringend erforderlich. Nach dem UNESCO-Bericht von 2008 gilt Zazaki als “gefährdet”, wobei das von AlevitInnen gesprochene Nord-Zazaki im Vergleich zu den sunnitischen Dialekten besonders bedroht ist. Abgesehen von Regionen wie Varto, Hınıs und Tekman wird Zazaki in ehemals zentralen Siedlungsgebieten wie Dersim, Erzincan oder Karabel inzwischen kaum mehr an Kinder weitergegeben.
Aktaş, Kazım 1999: Ethnizität und Nationalismus. Ethnische und kulturelle Identität der Aleviten in Dersim. Frankfurt.
Andrews, Peter Alford 1989: Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Wiesbaden (Türkçe çevirisi: Türkiye’de etnik gruplar).
Arakelova, Victoria 1999: “The Zaza People as a New Ethno-Political Factor in the Region”. In: Iran & the Caucasus, Volume 3/4. S. 397-408. Leiden. Online: http://www.jstor.org/stable/4030804 (Şubat 2021).
Aratemür, Yaşar 2011: “Arkaik Kaynaklardan Modern kaynaklara Zazalar ve Zazaca”. In: 1. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, S. 227-246. Online: https://www.academia.edu/11941017/I_Uluslararası_Zaza_Dili_Sempozyumu_Bildiri_Kitabı_Editör_ (Şubat 2021).
Aratemür, Yaşar 2012: “Zazaca’nın Temel Kelime Hazinesinden Bazı Kelimelerin Diğer Hint Avrupa Dilleri ile Karşılaştırılması”. In: 2. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü ve Sempozyumu, Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, S. 270-285. Online: https://www.academia.edu/11941306/II_Uluslararası_Zaza_Tarihi_ve_Kültürü_Sempozyumu_Bildiri_Kitabı_Editör_ (Şubat 2021).
Aratemür, Yaşar 2013: Etymologisch-vergleichendes Glossar des iranischen Anteils im Wortschatz des Zazaki (Bachelorarbeit). LMU München.
Aratemüt, Yaşar 2014: “İki Örnekle Avrupa’da ki Dilsel Azınlıkların Konumu; Zaza Dili İçin Bir Örneklem”. In: 2. Uluslararası Dersim Sempozyumu – Eylül 2013, Tunceli: Tunceli Üniversitesi, S. 792-806. Online: ftp://ftp.sakarya.edu.tr/KUTUPHANE/dersim.pdf (Şubat 2021).
Aratemür, Yaşar 2015: Phonologie der Zaza-Sprache der Stadt Bingöl und Umgebung (Masterarbeit). LMU München.
Arslan, İlyas 2007: Partikeln im Zazaki. Yayınlanmamış yükses lisans tezi. Köln. İnternette: http://www.kirmancki.de/Partikeln_im_Zazaki.pdf (Mart 2011)
Arslan, Ilyas 2016: Verbfunktionalität und Ergativität in der Zaza-Sprache (Doktora tezi). Online: http://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=37123 (Mart 2016).
Arslan, İlyas 2022: Zonê Zazaki de gırê sentakşi u semantiki. Filolojide güncel araştırmalar / Current Research in Philology. Haziran / June 2022. S. 115-130. Editör: Doç. Dr. Gülnaz Kurt. Ankara. Online: https://www.researchgate.net/publication/387867867_Zone_Zazaki_de_Gire_Sentaksi_u_Semantiki (Şubat 2025).
Arslan, Zeynep 2016: Eine religiöse Ethnie mit Multi-Identitäten. Die europäisch-anatolischen Alevit_Innen auf dem Weg zur Institutionalisierung ihres Glaubenssystems. Viyana.
Asatrian, Garnik. S. / Gevorgian, N. Kh. 1988:” Zāzā Miscellany: Notes on some religious customs and institutions.” In: Hommage et Opera Minora (Acta Iranica). Volume XII. Leiden.
Asatrian, Garnik 1995: “Dimlī”. In: Encyclopedia Iranica. Online: http://www.iranicaonline.org/articles/dimli (September 2011)
Asatrian, Garnik S. / Vahman, F. 1990: “Gleanings from Zāzā Vocabulary”. In: Acta Iranica. Volume XVI, S. 267-275. Leiden.
Azbak, Dilek 2013: Eine vom Aussterben bedrohte iranische Sprache: Kırmancki (Zazaki). Açıklanmamış bitirme tezi. Freie Universität, Institut für Iranistik, Berlin.
Bläsing, Uwe 1995: “Kurdische und Zaza-Elemente im türkeitürkischen Dialektlexikon”. Etymologische Betrachtungen ausgehend vom Nordwestiranischen. Dutch Studies (Published by Nell). Vol 1 Nr. 2. s. 173-218. Near Eastern languages and literatures. Leiden.
Bläsing, Uwe 1997: “Irano-Turcia: Westiranisches Lehngut im türkeitürkischen Dialektmaterial”. Studia Etymologica Craconviensia. Vol. 2. s. 77-150. Kraków.
Bläsing, Uwe 1997b: “Asme, Asmen, Astare”. Iran & Caucasus. Vol. 1, s. 171-178. Leiden.
Blau, Joyce 1989: “Gurânî et zâzâ”. Compendium Linguarum Iranicarum. Rüdiger Schmitt (Hrsg.), s. 336-340. Wiesbaden.
Bozbuğa, Rasim 2017: Kimlikleşme kavşağında Zaza kimliği ve Zaza hareketi. Doktora tezi. İnternette: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=vvA0vvEeGlqN-r1Wm2wItQ&no=9byRdOr7yCvCsu1n4jRkbg (Ekim 2021)
Cengiz, Daimi 2010: Dizeleriyle Tarihe Tanik Dersim Sairi: Sey Qaji (1860-1936). İstanbul.
Çağlayan, Hüseyin 1995: Die Schwäche der türkischen Arbeiterbewegung im Kontext der nationalen Bewegung (1908-1945). Frankfurt.
Çağlayan, Hüseyin 2020: Türkiye Toplumu’nda Zazaların Sosyolojik ve Demografik Durumu. In: ASOS (The Journal of Academic Social Sciences). Nr. 111. S. 145-159. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.43958 (Şubat 2025).
Çelik Dincer, Aysel 2021: Belirleyici Öbeği Varsayımı açısından Zazacada İzafe Yapıları: Sözdizimsel bir Çözümleme. Yayınlanmamış master tezi. Ankara Üniversitesi.
Dehqan, Mustafa 2010: Diyarbakır’dan bir Zazaca Alevi metni. Orijinali: http://www.kurdologie-wien.at/images/stories/MustafaDehqan/A%20Zazaki%20Alevi%20Treatise%20from%20Diyarbekir.pdf (Aralık 2010)
Fırat, Gülsün 2010: Dersim’de etnik kimlik: Herkesin bildiği sır: Dersim. İstanbul.
Gholami, Saloumeh 2002: “Ṭabaqebandī-ye zabān-e Zāzākī bar pāye-ye gūyeššenāsī-ye edrākī va zabānšenāsī-ye taṭbīqī” (“Zazaki dilinin algısal lehçebilim ve karşılaştırmalı dil bilim temelinde sınıflandırılması”) [Farsça]. Iranian Journal of Comparative Linguistic Research. Yıl 11, Sayı. 22. DOI: 10.22084/RJHLL.2021.24754.2169.
Gippert, Jost 1996: “Die historische Entwicklung der Zaza-Sprache”. Dergi: Ware. Pêseroka Zon u Kulturê Ma: Dımıli-Kırmanc-Zaza, 10. sayı, s. 148-154. Türkçesi: “Zazacanın tarihsel gelişimi”. Ware. Pêseroka Zon u Kulturê Ma – Zaza Dili ve Kültürü Dergisi, 13. sayı, s. 106-113.
Gippert, Jost 2007/2008: “Zur dialektalen Stellung des Zazaki”: Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Wiesbaden.
Gündüzkanat, Kahraman 1997: Die Rolle des Bildungswesens beim Demokratisierungsprozeß in der Türkei unter besonderer Berücksichtigung der Dimili (Kirmanc-, Zaza-) Ethnizität. Münster.
Hakobyan, Gohar (2017): Lexical similarities of Zāzāki and Ṭālešī. In: Zazaki – yesterday, today and tomorrow, S. 33-54. Graz.
Türkçesi: (2017): Talişçe ve Zazacada Sözlüksel Benzerlikler. Zazaca – Dünü, Bugünü ve Yarını, S. 31-52. Graz.
Jacobson, C.M. 1993: Rastnustena Zonê Ma. Handbuch für die Rechtschreibung der Zaza-Sprache. Bonn.
Jacobson, C.M. 1997: ZAZACA Okuma-Yazma El Kitabı. Bonn.
Jacobson, C.M. 2001: Rastnustena Zonê Ma. Zazaca Yazım Kılavuzu. Istanbul.
Kausen, Ernst 2006: Zaza. https://zazaki.de/files/Ernst-Kausen-Zaza.pdf (son erişim: 21.04.2025)
Kausen, Ernst 2012: Die indogermanischen Sprachen. Hamburg.
Kehl-Bodrogi, Krisztina 1998: “Wir sind ein Volk!” Identitätspolitiken unter den Zaza (Türkei) in der europäischen Diaspora, Bd. 48/2, Sociologus, S. 111-135.
Keskin, Mesut 2008: Zur dialektalen Gliederung des Zazaki. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/6284/ (Ocak 2010).
Keskin, Mesut Asmên 2025: Identitätsdynamik und Ethnizität der Zaza-sprachigen Bevölkerung zwischen Fremdzuschreibung und Selbstverortung. Eine Analyse kollektiver Wahrnehmungen im Spiegel der Forschung und empirischer Umfragen. Münster.
Korn, Agnes 2003: “Balochi and the Concept of North-West Iranian” in: The Baloch and Their Neighbours: Ethnic and Linguistic Contact in Balochistan in Historical and Modern Times. Wiesbaden, pp. 49-60.
Korn, Agnes 2019: “Isoglosses and subdivisions of Iranian” in: Journal of Historical Linguistics. Pp. 239-281.
Lerch, Peter I. 1857/58: Forschungen über die Kurden und die Iranischen Nordchaldäer. St. Petersburg.
Comerd 1995-2000: İtıqatê Dêsımi – Dersim İnancı yazı dizisi. Ware dergisi, sayı 8-13. Baiersbronn.
Malottke, Tanja 2007: Lehnwortadaption im Zazaki. Üniversite ödevi. Düsseldorf/München (dijital baskı).
MacKenzie, David N. 1995: “Notes on southern Zaza (Dimilî),” in: Proceedings of the second European Conference of Iranian Studies, Rome, 1995, pp. 401-14.
Mann, Oskar / Hadank, Karl 1932: Die Mundarten der Zâzâ, hauptsächlich aus Siverek und Kor. Leipzig.
Maurais, Jacques 1978: Iranian Dialectology: Papers on Zaza. Online: http://membre.oricom.ca/jamaurais/Zazapage.htm (Ağustos 2014)
Paul, Ludwig 1998a: Zazaki. Grammatik und Versuch einer Dialektologie. Wiesbaden.
Paul, Ludwig 1998b: “The Position of Zazaki among West Iranian Languages.” Old and Middle Iranian Studies Part I, ed. Sims Williams. S. 163-176. Proceedings of the 3rd European Conference of Iranian Studies (held in Cambridge, 11th to 15th September 1995). Wiesbaden.
Paul, Ludwig 2008: “Kurdish Language I. History of the Kurdish Language”. Encyclopaedia Iranica. Online: http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-language-i
Paul, Ludwig 2009: “Zazaki”. The Iranian Languages (Ed. Gernot Windfuhr). s. 545-586. Michigan.
Philipp, Maria 2017: My Mother Tongue; My Mother’s Tongue. The Role of Zazaki for Zazas Raised During the Language Prohibition. Yayınlanmamış yükses lisans tezi. Frankfurt/Oder.
Pirejko, L. A. 1999: “Zaza Jazyk”. Jayzki Mira – Iranskie jazyki. II. Severo-zapadnye iranskie jazyki. S. 73-77. Moskova.
Sandonato, M. 1994: “Zazaki”. Typological studies innegation, eds. Peter Kahrel, René van den Berg. S. 125-142. Amsterdam.
Schirru, Giancarlo 2017: “Osservazioni sull’esponenza del femminile in zāzā” Al femminile. Scritti linguistici in onore di Cristina Vallini. Meo, Anna de; Di Pace, Lucia; Manco, Alberto; Monti, Johanna; Pannain, Rossella (Hrsg.). Floransa.
Schmitt, Rüdiger (Hrsg.) 1989: Compendium Linguarum Iranicarum [CLI]. Wiesbaden.
Schmitt, Rüdiger 2000: Die Iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden.
Schulz-Goldstein, Esther 2013: Die Sonne blieb stehen. Der Genozid in Dêsim 1937/38. Band 2. Neckenmarkt, Avusturya.
Selcan, Zülfü 2001: Zaza Dilinin Gelişimi. http://zilfiselcan.net/wp-content/uploads/2016/11/ZazaDilininGelisimi_A4_tr.pdf (Zuletzt geprüft am: 21.04.2025).
Selcan, Zülfü 1998a: Grammatik der Zaza-Sprache. Nord-Dialekt (Dersim-Dialekt). Berlin.
Selcan, Zülfü 1998b: “Die Entwicklung der Zaza-Sprache”. Ware. Pêseroka Zon u Kulturê Ma: Dımıli-Kırmanc-Zaza. 12. sayı, S. 152-163. Baiersbronn.
Spuler, Bertold (Hrsg.) 1958: Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Vierter Band, Iranistik. Erster Abschnitt Linguistik. Leiden-Köln.
Tahta, Selahattin 2002: Ursprung und Entwicklung der Zaza-Nationalbewegung im Lichte ihrer politischen und literarischen Veröffentlichungen. Yayınlanmamış yükses lisans tezi. Berlin.
Taş, Cemal 2007: Roê Kırmanciye (Hesen Aliyê Sey Kemali’nin ağzından). İstanbul.
Taşçı, Hülya 2006: Identität und Ethnizität in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der zweiten Generation der Aleviten aus der Republik Türkei. Münster.
Temizbaş, Suvar 1999: Einflüsse des Deutschen auf die Dimli-Sprache. Yayınlanmamış yükses lisans tezi. Halle, Almanya.
Törne, Annika 2020: Dersim – Geographie der Erinnerungen. Berlin.
Todd, Terry L. 1985: A Grammar of Dimili (also known as Zaza). Ann Arbor, Michigan.
Trompf, Garry W. (2013): Ethno-Religious Minorities in the Near East: Some Macrohistorical Reflections with Special Reference to the Zazas. In: Iran Cauc 17 (3), S. 321-344. DOI: 10.1163/1573384X-20130306.
Werner, Brigitte 2006: Features of Bilingualism in the Zaza Community. Paper. Philipps University Marburg. Online: https://www.zazaki.de/files/Brigitte-Werner-Features-of-Bilingualism-in-the-Zaza-Community.pdf (son erişim: 25.04.2025).
Werner, Brigitte 2018: “Forms and Meanings of the Ezafe in Zazaki”: Endangered Iranian Langauges. Saloumeh Gholami (Ed.). Wiesbaden.
Werner, Eberhard 2013: Text Discourse Features In Southern Zazaki (Çermik/Siverek Dialect) – A Glance at some Folktales. SIL Electronic Working Papers. 5th International Conference of Iranian Linguistics, 25th-27th 2013. Bamberg. İnternette: https://www.zazaki.de/files/Eberhard-Werner-Text-discourse-features-in-southern-Zazaki.pdf (Zuletzt geprüft am: 21.04.2025).
Werner, Eberhard 2015: “Communication and the Oral-Aural Traditions of an East-Anatolian Ethnicity: What us Stories tell!”. In: Studies on Iran and The Caucasus. In Honour of Garnik Asatrian. Bläsing, Arakelova, Weinreich (Hrsg.). S. 667-691. Leiden.
Werner, Eberhard 2017: Rivers and Mountains; A Historical, Applied Anthropological and Linguistical Study of the Zaza People of Turkey including an Introduction to applied Cultural Anthropology. Nürnberg: VTR. Online: URL https://www.sil.org/system/files/reapdata/14/51/04/145104848891296233406385379116832916897/The_Rivers_An_anthropological_study_Eberhard_Werner_07_November_2017.pdf (Mart 2018)
Werner, Eberhard 2021: “The Zaza People – A Dispersed Ethnicity”: The Ethno-Cultural Others of Turkey: Contemporary Reflections. Garnik Asatrian (Ed.). S 121-143. Erivan. İnternette: https://orient.rau.am/uploads/institute/pdf/files/THE%20ETHNO-CULTURAL%20OTHERS%20OF%20TURKEY%20(1)yzbHn0pBlq30MtD1625302066.pdf (Temmuz 2021)
Windfuhr, Gernot (Ed.) 2009: The Iranian Languages. Michigan.