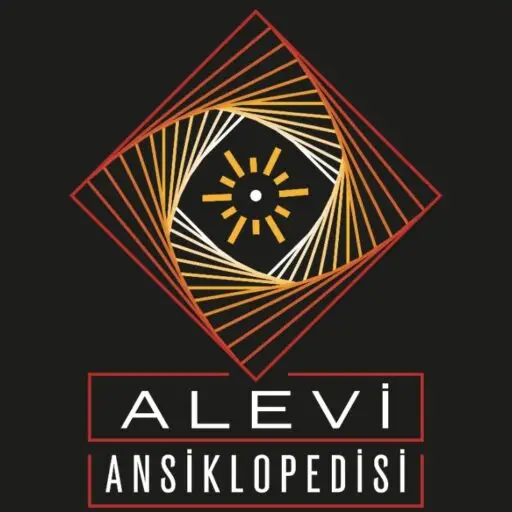Musik der Zaza
* Dieser Eintrag wurde ursprünglich auf Englisch verfasst.
Die Musik der Zaza (Kırmanj–Dimilî) sprechenden Bevölkerung in Anatolien ist noch wenig erforscht, sodass ein umfassender Überblick über ihre musikalischen Traditionen noch nicht möglich ist. Verschiedene Dialekte der Sprache werden in einem weiten Gebiet gesprochen, das sich von Sivas bis Urfa erstreckt, und sowohl die musikalischen Praktiken als auch die wissenschaftliche Forschung variieren erheblich. Am bekanntesten ist die Musik der Zaza in Dersim, wo Klagelieder und religiöse Lieder die bekanntesten Formen sind. Aus weiter östlich gelegenen Regionen sind zumindest einige Musiker und Repertoires bekannt, während die Musik der sunnitischen Zaza-Gemeinschaften noch nicht erforscht wurde. Die oft diskutierte Frage, ob es eine jeweils eigenständige Musiksprachen der „Zaza” oder der „Kurden” gibt, kann aufgrund des fast vollständigen Fehlens historischer Dokumente auf wissenschaftlicher Grundlage nicht beantwortet werden. Die frühesten Aufnahmen von Zaza-Liedern stammen erst aus der Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts. Seit dem späten 20. Jahrhundert hat sich die Musik der Zaza unter dem Einfluss von Migration, Urbanisierung und der Entwicklung der Musikindustrie erheblich verändert.Die Musik der Zaza (Kırmanj-Dimilî) sprechenden Bevölkerung in Anatolien ist noch kaum erforscht, sodass ein umfassender Überblick über ihre musikalischen Traditionen bislang nicht möglich ist. Verschiedene Dialekte dieser Sprache werden in einem weiten Gebiet gesprochen, dass Teile der Provinzen Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Siirt, Urfa und Adıyaman umfasst (Çağlayan, 2016; Kaya, 2011; Lezgin, 2016; Özcan & Çağlayan, 2019). Innerhalb dieser ausgedehnten Region unterscheiden sich die musikalischen Praktiken erheblich voneinander.
Das heute am besten dokumentierte Repertoire stammt aus Zentral-Dersim, einer überwiegend zaza-sprachigen Region (Aslan, 2010; Erdoğan, 2023; Greve & Kızıldağ, 2025 (in Kürze erscheinend); Greve & Şahin, 2019; Önal, 2021; Önder & Şenol, 2018; Özcan, 2003). Neben ihrer Sprache zeichnet sich die Region jedoch noch durch zwei weitere Merkmale aus: vor allem durch ihre traumatische Geschichte, insbesondere die Massaker von 1937-38. Die heute mit Abstand bedeutendste literarische und musikalische Tradition in Dersim sind Klagelieder, die solo oder mit Begleitung von Instrumenten wie der tembur-Laute oder der europäischen Geige gesungen werden. Die meisten der erhaltenen Lieder erzählen von Ereignissen aus diesen gewaltvollen Jahren. Zu den bekanntesten Dichter-Sängern gehören Sej Qaji (ca. 1871-1936), Weliyê Wuşenê Yimami (1889-1958), Alaverdi (1921-1983), Hüseyin Doğanay (1940-2005) und Sait Baksi (geb. 1943) (Cengiz, 2010). Liebeslieder und Lieder über andere Themen scheinen vor 1937 weiter verbreitet gewesen zu sein, hinzu kommen Tanzliedern, die oft ohne Instrumentalbegleitung gesungen wurden. Auch andere tragische Ereignisse – wie Lawinen oder Konflikte zwischen Stämmen – waren Gegenstand von Liedern. Darüber hinaus war es in Dersim möglich, bekannte Dichter-Sänger zu beauftragen, Klagelieder zum Gedenken an verstorbene Verwandte oder Bekannte zu dichten.
Ein zweites charakteristisches Merkmal von Dersim ist der Alevitentum mit seinen lokalen Traditionen bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einige dedes (pirs) führten in Dersim Zeremonien ausschließlich in Zaza durch und sangen auch eine Vielzahl religiöser Lieder in dieser Sprache (Cengiz, 2014). Auf der anderen Seite sind aber auch religiöse Lieder in Türkisch und sogar Kurmanji erhalten geblieben und werden bis heute aufgeführt.
In benachbarten Regionen, in denen verwandte Dialekte des Zaza gesprochen werden, etwa Qerebel/Karabel (östliches Sivas), Karer (zentrales Bingöl) und Varto-Hınıs (zwischen Erzurum und Muş), scheinen musikalische Traditionen weitgehend denen von Dersim zu ähneln, soweit dies anhand der verfügbaren Informationen beurteilt werden kann. Klagelieder und religiöse Praktiken sind in diesen Regionen ebenfalls verbreitet, jedoch fehlt die für Dersim charakteristische tief melancholische Atmosphäre, die offensichtlich durch die traumatische Geschichte geprägt wurde. In diesen benachbarten Gebieten behandeln Lieder in Zaza eher dörfliche Belange, kleinere Zwischenfälle oder zwischenmenschliche Konflikte. Tanzlieder, die oft Liebesgeschichten erzählen, sind in der gesamten Region weit verbreitet und werden sowohl in Zaza als auch in Kurmanji gesungen (Şahin, 2016). Östlich und südlich von Bingöl liegt die Region der dengbêjs, die fast immer in Kurmanji singen, selbst einige Zaza-sprachige dengbêjs in Bingöl oder Varto singen überwiegend in Kurmanji. Zaza-sprachige Dichter-Sänger wie Hıdır Baş (1955-2023) und Devrêş Baba (1938-1999) aus Varto hingegen scheinen stärker von alevitischen Liedtraditionen oder von türkischen âşık-Sängern beeinflusst worden zu sein.
Deutlich weniger ist über die Musik der zentralen und südlichen Zaza-Gemeinschaften bekannt, von denen die meisten dem sunnitischen Islam angehören. In diesen Gebieten sind islamische Gesänge und Rezitationen – wie qeside, ilahi, mevlîd und beyîd – weit verbreitet. Es ist unklar, ob diese Genres lokale Stilmerkmale aufweisen oder vielmehr einem breiteren, panislamischen anatolischen Stil entsprechen. Die einzige Veröffentlichung, die sich mit dieser Frage befasst, eine Studie über mevlîds in zaza-Sprache (Tıraşçı, 2012), legt Letzteres nahe. Nur zwei Sänger aus Bingöl haben über ihren lokalen Kontext hinaus begrenzte Bekanntheit erreicht: Rêncber Ezîz (1955-1988, Karasu, 2012) und Sait Altun (gest. 2018). Ihr Musikstil unterscheidet sich deutlich von dem in Dersim. Rêncber Ezîz, beeinflusst von den linken Musikbewegungen seiner Zeit, nahm sogar uzun havas in sein Repertoire auf. Sait Altun hingegen war vor allem für seine Auftritte bei Hochzeiten und öffentlichen Feierlichkeiten bekannt, wo er sich in der Regel auf einer elektrischen saz begleitete.
Derzeit ist nichts über Lieder oder Sänger in Zaza aus weiter südlich gelegenen Provinzen wie Diyarbakır und Urfa oder aus den kleineren zazaischsprachigen Enklaven in Kayseri, Kars und Ardahan bekannt. Zu den bekannteren Zaza-Musikern gehört Mehmet Akbaş aus Dicle-Pîran, der heute in Köln lebt.
Insgesamt ist es kaum möglich, gemeinsame Merkmale einer Zaza-sprachigen Musiktraditionen zu identifizieren. Viele der Liedformen – lawik, deyir, kelûm, lûrikî (Wiegenlieder) und siware (Klagelieder) – ähneln entsprechenden Genres, die in anderen anatolischen Sprachen aufgeführt werden.
Zaza und Kurmanji Musik
Ein ernsthafter, systematischer Vergleich zwischen den musikalischen Traditionen von Zaza- und Kurmanji sprechenden Gemeinschaften ist bislang nie versucht worden. Eine offensichtliche Schwierigkeit besteht darin, dass selbst Kurmanji sprechenden Traditionen keine musikalische Einheit bilden. Musik scheint sich schneller zu verändern und anzupassen als Sprache und kann daher nur anhand von Tonaufnahmen – die höchstens bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zurückreichen – oder anhand von notierten Quellen nachverfolgt werden, wie sie im Falle von Liedern in Zaza-Sprache erst seit dem späten 20. Jahrhundert existieren. Dies unterscheidet historische Musikforschung von der vergleichenden Sprachforschung, die die Geschichte und die Wechselbeziehungen von Sprachen allein auf der Grundlage des zeitgenössischen Sprachgebrauchs rekonstruieren kann.
In der gesamten kurdischen Bevölkerung des Nahen Ostens weisen musikalische Traditionen nur wenige einheitliche Merkmale auf, die als allgemein gültig für alle Kurden angesehen werden könnten. Obwohl kurdische Volkstänze und epische Traditionen wie die der dengbêjs in einigen Regionen gemeinsame strukturelle oder stilistische Merkmale haben, gibt es eine große Vielfalt an regional und religiös unterschiedlichen Formen von Gesang und Rezitation. So unterscheidet sich etwa die Musik von Hakkâri deutlich von der aus Dersim oder dem West-Iran. Vergleichbare musikalische Praktiken können in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet werden (Allison 2001), während dieselben Begriffe je nach lokalem Sprachgebrauch unterschiedliche Bedeutungen haben können. Selbst innerhalb des zentralen Dersim lässt sich kein einheitlicher musikalischer Kurmanji- Stil identifizieren, der sich klar von dem der Zaza-sprachigen Gemeinschaften unterscheidet. Der melodische Stil von Mahmut Baran (1923-1975) und seinem Sohn Ali Baran (geb. 1956), die im Dorf Bargini (Karabakır, Bezirk Hozat) lebten und kılams zur Begleitung von bağlamas aufführten, unterscheidet sich deutlich von den dengbêjs in Kiğı oder von den Liedern in Muhundu.
Während zahlreiche Wissenschaftler über “kurdische Musik” geschrieben haben, gibt es bislang nur eine Veröffentlichung, die sich speziell mit den musikalischen Traditionen der Zaza befasst: Beltekins Artikel “Music among the Zazas” (Beltekin 2019). Die Studie konzentriert sich in erster Linie auf die Liwdertexte und weniger auf musikalische Strukturen. Beltekins Fokus liegt auf dem Sänger Rêncber Ezîz aus Bingöl, obwohl der Artikel auch eine Reihe sunnitischer religiöser Musikgenres qeside, ilahi, mevlîd und beyîd, sowie verschiedene Liedformen wie lawik, deyir, kelâm, Liebes- und Arbeitslieder, lûrikî (Wiegenlieder), şîware (Klagelieder) und Instrumentalstücke behandelt. Keine dieser Musikformen ist jedoch ausschließlich bei Zaza-Sprechern bekannt, vielmehr sind sie in verschiedenen sprachlichen und kulturellen Kontexten Anatoliens verbreitet.
Vergleiche mit den musikalischen Traditionen weiterer verwandter Sprachen, wie beispielsweise Gurani im Nordwesten Irans, bleiben aufgrund fehlender wissenschaftlicher Studien und historischer Quellen derezeit weitgehend spekulativ (Hooshmanddrad 2004). Es lassen sich höchstens oberflächliche Ähnlichkeiten feststellen, etwa die weit verbreitete Verwendung von Langhalslauten, die aber in vielen Sprachgemeinschaften üblich sind.
Die häufig diskutierte Frage, ob es eine eigenständige Musiksprache der Zaza oder der Kurden gibt, kann aufgrund von fast völlig fehlenden historischen Ton-Dokumenten wissenschaftlich nicht beantwortet werden. Die frühesten Tonaufnahmen von Zaza-Liedern stammen erst aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Solche Quellen reichen nicht aus, um eine seriöse Theorie über die “Ursprünge” von Musik einer bestimmten sozialen Gruppe oder über Musikstrukturen, die mehrere Jahrhunderte zurückreichen, zu formulieren.
Jüngere Entwicklungen
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Abwanderung in die Städte dazu geführt, dass viele Dörfer – insbesondere solche, die von ethnischen oder religiösen Minderheiten bewohnt werden – weitgehend verlassen sind und nur noch wenige ältere Einwohner dauerhaft dort leben. Umgekehrt haben sich Städte wie Tunceli, Bingöl und Varto zu neuen urbanen Zentren entwickelt. Die frühere Praxis, direkt für Bekannte und Verwandte im Dorf zu singen, ist verdrängt worden durch eine Verbreitung von Musik durch Massenmedien, produziert mit professionellen Arrangements in Tonstudios. Die Musik in Zaza-Sprache wurde politisiert, während andere Interpreten versuchten, auf dem größeren türkischen Markt erfolgreich zu werden.
Ab 1961 migrierten viele Zaza-Sprecher nach Europa, oft aufgrund der Unterdrückung ihrer Muttersprache und des Alevitentums durch den türkischen Staat. Seit den 1990er Jahren wurden in Europa zahlreiche Dersim- und Varto-Vereine sowie alevitische Organisationen gegründet, in denen heute auch viele Zaza-Sprecher eine aktive Rolle spielen. Seitdem finden regelmäßig große Konzerte und Festivals mit Zaza sprechenden Künstlern in ganz Europa statt, die sowohl türkische als auch nicht-türkische Zuschauer anziehen. Die meisten heute bekannten Zaza-Sänger leben in Europa oder haben zumindest einen Teil ihres Lebens dort verbracht: Yılmaz Çelik (Basel/Dersim), Kemal Kahraman (Berlin/Dersim), Sakina Teyna (Wien), Mikail Aslan (Mainz), Ahmet Aslan (Köln/Rotterdam/Istanbul), Zelemele (Düsseldorf), Mehmet Çapan (Kornwestheim), Rêncber Ezîz (1955-1988; zuletzt Bremen), Seîd Altun (1949-2018, Deutschland), Nilüfer Akbal (Köln), Lütfü Gültekin (Brüssel), Ozan Serdar (Bonn), Mehmet Akbaş (Köln), Maviş Güneşer (Berlin), Ferhat Tunç (Rüsselsheim), Ali Asker (Straßburg) und Taner Akyol (Berlin) (Greve und Şahin 2019).
Die Musik der Zaza hat sich in Europa stark verändert. Einerseits versuchten viele Migranten, alte Musiktraditionen zu bewahren, indem sie diese vor ihrem Verschwinden aufnahmen und dokumentierten. In Europa lebende Sammler wie Daimi Cengiz, Musa Canpolat, Hawar Tornecengi, Zilfi Selcan, Metin und Kemal Kahraman, Hüseyin Erdem und Tevfik Şahin bauten über viele Jahre hinweg umfangreiche Archive mit historischen Musikaufnahmen auf. Musiker konsultierten diese Sammler häufig und rekonstruierten Traditionen auf der Grundlage solcher Aufnahmen. Gefördert von der europäischen Diaspora blühte seit den 1990er Jahren ein “Dersim-Revival”, das oft die Musik anderer Zaza-Regionen verdeckte.
Auf der anderen Seite hat sich die Musik in Europa weiterentwickelt. Die Brüder Metin und Kemal Kahraman beispielsweise arrangierten Lieder mit europäischen Instrumenten wie Gitarre, Violine und Flöte, und Zelemele sang Zaza-Lieder im Stil von Rock und Hip-Hop. Während seines Studiums am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz (2001-2005) arrangierte Mikail Aslan das Liedes Munzur für Orchester, während Ahmet Aslan am Konservatorium von Rotterdam Codarts Flamencogitarre lernte. Taner Akyol komponierte gar zeitgenössische neue Musik über die Massaker von 1938; sein Stück Tertele für Kammerorchester wurde in der Elbphilharmonie in Hamburg uraufgeführt (Greve und Şahin 2019).
Schlussfolgerung
Der Text zeigt, dass die musikalischen Traditionen der Zaza- (Kırmanj-Dimilî-) sprechenden Gemeinschaften sowohl geographisch als auch historisch stark fragmentiert, lokal verankert und bislang nur unzureichend dokumentiert sind. Zentrale Hindernisse für eine umfassende Bewertung der Zaza-Musik sind die weite räumliche Verbreitung unterschiedlicher Dialekte, ausgeprägte regionale und religiöse Differenzierungen sowie insbesondere der gravierende Mangel an historischen schriftlichen und audiovisuellen Quellen. Vor diesem Hintergrund ist es analytisch nicht haltbar, von einer einheitlichen oder homogenen “Zaza-Musik” zu sprechen.
Das zentrale Argument des Textes besteht darin, dass Dersim innerhalb dieses Gefüges eine Ausnahmestellung einnimmt. Die Musiktradition Dersims hat – geprägt durch den alevitischen Glauben und die traumatische Geschichte der Massaker von 1937-38 – eine klagezentrierte, tief melancholische Ästhetik entwickelt. Musik fungiert hier nicht primär als ästhetische Praxis, sondern als Trägerin kollektiver Erinnerung und des Gedenkens. Die zentrale Rolle der Zaza-Sprache in Cem-Ritualen und religiösen Gesängen positioniert Dersim zudem als sprachliches und religiöses Zentrum musikalischer Praxis. Zwar bestehen in benachbarten Zaza-Regionen Überschneidungen mit der Dersimer Musiktradition, doch fehlt dort eine vergleichbare, durch historische Traumata geprägte ästhetische Verdichtung.
Der Text verdeutlicht ferner, weshalb bislang kein systematischer Vergleich zwischen Zaza- und Kurmanci-Musiktraditionen vorliegt. Musik erweist sich als eine Praxis, die sich schneller wandelt als Sprache und stark von regionalen sowie religiösen Kontexten beeinflusst wird. Vor diesem Hintergrund besitzen übergeordnete Kategorien wie “kurdische Musik” oder “Zaza-Musik” angesichts der gegenwärtigen historischen und ethnomusikologischen Quellenlage nur eine begrenzte analytische Tragfähigkeit.
Ein wesentlicher Beitrag des Textes liegt schließlich in der Analyse des prägenden Einflusses der europäischen Diaspora auf die Zaza-Musik. Migration ermöglichte einerseits die Dokumentation und Bewahrung älterer Repertoires, andererseits die Entstehung neuer ästhetischer Ausdrucksformen, hybrider Musikstile und eines seit den 1990er Jahren wirksamen “Dersim-Revivals”. Dieses Revival hat die Zaza-Musik in einen transnationalen Kontext überführt und sie zu einem dynamischen kulturellen Feld gemacht, in dem Erinnerung, Politik und künstlerische Innovation eng miteinander verflochten sind.
Allison, Christine. 2001. The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan. Richmond, Surrey: Curzon.
Aslan, Mahmut. 2010. “Müzik ve Kültürel Kökler Bağlamında Dersim Müziği.” İçinde Herkesin Bildiği Sır: Dersim, haz. Şeref Aslan, 197-220. İstanbul: İletişim Yayınları.
Beltekin, Nihat. 2019. “Zazalarda Müzik.” İçinde Sözden Yazıya Zazaca, haz. Nuri Baran Akın ve M. Kırkan, 233-259. İstanbul: Peywend Yayınları.
Çağlayan, Ercan. 2016. Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Cengiz, Daimi. 2010. Dizeleriyle Tarihe Tanık Dersim Şairi Sey Qaji. İstanbul: Horasan Yayınları.
Cengiz, Daimi. 2014. “Kureyşan (Khuresu) Ocağı’nın Cem Ritüeli ve Ritüel Musikisi.” Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3: 56-94.
Erdoğan, Ali. 2023. “Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Alevilik ve Müzik (Tunceli Örneği).” Edep Erkan 4: 121-140.
Greve, Martin, ve Deniz Kızıldağ. 2025 (basımda). Musical Traces of a Lost Past: Looking for Greater Dersim. Würzburg: Ergon Verlag.
Greve, Martin, ve Özge Şahin. 2019. Anlatılamazı İfade Etmek: Dersim’in Yeni Sound’unun Oluşumu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Hooshmandrad, Parisa. 2004. Performing the Belief: Sacred Music Practice of the Kurdish Ahl-e Haqq of Gûrân. Doktora tezi, University of California, Berkeley.
Kaya, Mehmet Sait. 2011. The Zaza Kurds of Turkey: A Middle Eastern Minority in a Globalised Society. London: I.B. Tauris.
Lezgîn, Reşat Ali. 2016. Toplumsal Kürt Gruplarından Zazalar: Köken, Coğrafya, Din, Dil, Edebiyat. Diyarbakır: Roşna Yayınları.
Önal, Özkan. 2021. “Mazgirt Müzik Kültüründe Oyun Ezgileri Geleneği.” İçinde Mazgirt, 698-713. İstanbul: Ütopya Yayınları.
Önder, Erdal, ve Özlem Şenol. 2018. “Hozat’ta Müzik Kültürü.” İçinde Hozat, haz. Şeref Aslan ve Zeynep Hepkon, 214-237. İstanbul: Ütopya Yayınları.
Özcan, Metin. 2003. Kürdün Gelini: Notalarıyla Tunceli Halk Türküleri ve Oyun Havaları. Ankara: Kalan Yayınları.
Özcan, Metin, ve Hamit Çağlayan. 2019. Tarihsel ve Sosyolojik Gelişimi ile Zazaca: Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Folklor. Tunceli: Kalan Yayınları.
Şahin, Turgay. 2016. Lawıkê Qerebêli u Qoçgiriye. İstanbul: Tij Yayınları.
Tıraşçı, Mehmet. 2012. “Zazaca Mevlidler ve Müzikal Olarak İcra Ediliş Tarzları.” İçinde II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültür Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), haz. Mehmet Varol, 676-687. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları.