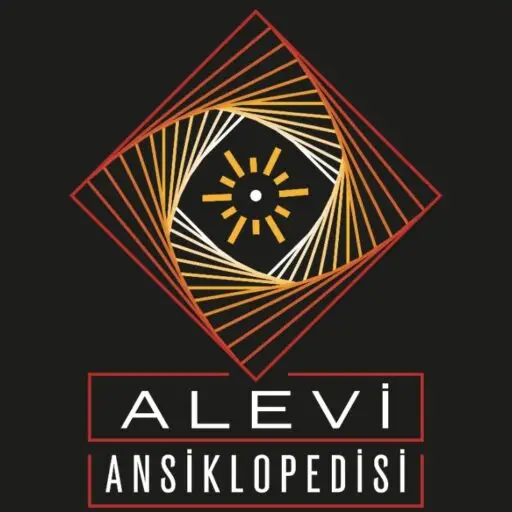Eine Initiative, um das Wissen des Alevitentums in die Zukunft zu tragen
Das Projekt Alevi-Enzyklopädie, das im März 2024 unter der Leitung der Rıza-Şehri-Akademie ins Leben gerufen wurde, entstand als Antwort auf die Notwendigkeit, Wissen über das Alevitentum systematisch zu sammeln und weiterzugeben, die Verbreitung von Fehlinformationen in diesem Bereich zu verhindern und der anhaltenden epistemischen Gewalt gegen das Alevitentum entgegenzuwirken. Das Projekt stellt einen bedeutenden Schritt dar, Alevi-Wissen auf Grundlage der eigenen Bedeutungen, Gefühle, Stimmen und Symbole der Gemeinschaft zu produzieren und zu bewahren. Getragen von den Beiträgen einer breiten Gruppe von Wissenschaftlerinnen, Gemeindevorsteherinnen und Forscher*innen, ist diese Initiative ein wertvolles Unterfangen, dessen Wirkung weit in die Zukunft reichen wird.
Mit dem Ziel, sich im Jahr 2025 auf eine professionelle Grundlage zu stellen, will das Projekt der Alevi-Öffentlichkeit und der Welt eine leicht zugängliche, mehrsprachige, webbasierte Wissensplattform zur Verfügung stellen. Die Enzyklopädie wird Inhalte in Türkisch, Kurmancî, Kırmanckî, Englisch, Deutsch und Französisch veröffentlichen, um insbesondere die jüngeren Generationen in der Türkei und in der europäischen Diaspora mit der Geschichte, Soziologie, Anthropologie, Erinnerung und dem Wissen des Alevitentums zu verbinden.
Der Umfang des Projekts, seine bisherigen Fortschritte und seine künftigen Ziele wurden auf dem Alevi-Enzyklopädie-Symposium am 16.–17. November 2024 in Dortmund, Deutschland, diskutiert. Die zweitägige Veranstaltung brachte Wissenschaftlerinnen, religiöse Autoritäten, Vertreterinnen alevitischer Institutionen aus der Türkei und Europa sowie Mitglieder anderer historisch und kulturell verwandter Gemeinschaften wie Êzidîs und Yaresan/Kakai (Ehli Haq) zusammen, von denen viele – ähnlich wie die alevitische Diaspora – größtenteils im Exil leben. Im Symposium ging es um zentrale Fragen: Wie kann das Alevitentum, das heute sowohl physischer als auch epistemischer Gewalt ausgesetzt ist, seinen Glauben und seine kulturelle Identität in einem wissenschaftlichen Rahmen bewahren, und wie kann dieses Wissen mit zeitgemäßen Mitteln vermittelt werden? Darüber hinaus wurde erörtert, wie die Alevi-Enzyklopädie auf jüngste Initiativen wie die Alevi-Akademien zurückgreifen könnte, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten in der Türkei und in Europa rasant entwickelt haben, und wie sie das bestehende wissenschaftliche Wissen in diesem Feld bündeln könnte.
Am ersten Tag beleuchteten drei Panels verschiedene Beispiele aus der Türkei und Europa in Bezug auf die Sammlung und Weitergabe von Wissen über das Alevitentum.
Insbesondere wurden Probleme hervorgehoben, die sich aus staatlichen Politiken in der Türkei ergeben, welche die Sammlung und Weitergabe von Alevi-Wissen einschränken. Diskutiert wurden Eingriffe über Strukturen innerhalb von Universitäten und des Kulturministeriums, die oft nicht die kulturelle Vielfalt des Alevitentums widerspiegeln, sondern darauf abzielen, es in einem bestimmten ideologischen Rahmen neu zu konstruieren.
Als Antwort auf diese Politiken der epistemischen Gewalt hob das Symposium Bemühungen wie die Gründung von Alevi-Akademien in der Türkei hervor, die alternative Versuche darstellen, alevitisches Wissen zurückzugewinnen. Ebenso wurde die Zunahme wissenschaftlicher Arbeiten über das Alevitentum in Europa – wo vergleichsweise freiere Forschungsbedingungen bestehen – als bedeutsam diskutiert. Die Verbreitung der Alevi-Akademien in Europa wurde dabei als Erweiterung der Bemühungen der Gemeinschaft gesehen, eigene Wissensquellen in der Diaspora zu schaffen. In diesem Kontext wurde die Alevi-Enzyklopädie als ein Projekt mit großem Potenzial betrachtet, eine einigende Rolle zu übernehmen und eine korrekte Weitergabe und Repräsentation von Alevi-Wissen sicherzustellen.
Das Symposium befasste sich außerdem mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Reproduktion und Verbreitung von Alevi-Wissen. Die Übertragung der alevitischen Erinnerung in digitale Räume wurde als wesentlich anerkannt – sowohl für die Zugänglichkeit als auch für die Vielfalt des Wissens. Aktuelle Beispiele, wie Entwicklungen in Online-Plattformen und virtuellen Museen, wurden im Detail auf ihre möglichen wechselseitigen Beiträge mit der Alevi-Enzyklopädie hin untersucht.
Der zweite Tag des Symposiums konzentrierte sich auf die Widerstandserfahrungen verschiedener Gemeinschaften gegen Assimilation sowie auf theologische und soziale Aspekte des Alevitentums.
Êzidîs, Yaresan/Ehli Haq, Kakais und Raa Haq – alte Glaubensrichtungen Mesopotamiens und Anatoliens – wurden im Hinblick auf ihren Widerstand gegen Assimilationspolitiken ausführlich diskutiert. Dabei wurde untersucht, wie diese Gemeinschaften, die dem erzwungenen Vergessen ausgesetzt waren, ihren Widerstand durch Solidarität und gemeinsame Strategien des Kampfes aufrechterhalten haben. In diesem Zusammenhang wurde die Alevi-Enzyklopädie nicht nur als Ressource zur Bewahrung des Alevi-Gedächtnisses und -Wissens anerkannt, sondern auch als ein entscheidendes Werkzeug zur Sicherung der Erinnerung dieser alten Traditionen. Sie wurde als eine wichtige Plattform betrachtet, um kollektives Gedächtnis angesichts von Traumata neu zu konstruieren und seine Weitergabe an künftige Generationen zu gewährleisten.
Die grundlegenden Glaubensvorstellungen und Werte des Alevitentums wurden zudem von Pirler und Analar – den spirituellen Wegweiserinnen des „Yol“ – erörtert. Aufbauend auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und dem Landleben erklärten sie anschaulich alevitische Vorstellungen von Mensch und Universum, heiligen Orten sowie verschiedenen religiösen und sozialen Themen. Besonders die Diskussionen über die Heiligkeit der Natur und die theologischen wie praktischen Zugänge des Alevitentums zum Schutz des Lebens und der Umwelt hinterließen bei den Teilnehmerinnen einen tiefen Eindruck. Diese Dialoge betonten die friedliche und inklusive Identität des Alevitentums und unterstrichen die zentrale Rolle, die die Alevi-Enzyklopädie bei der Bewahrung und Weitergabe dieser Werte spielen kann.
In der abschließenden Sitzung des Symposiums hoben Vertreterinnen verschiedener alevitischer Institutionen aus der Türkei und Europa hervor, dass das Projekt der Alevi-Enzyklopädie eine historische Chance darstellt. Sie betonten, dass das Projekt nicht nur als ein Versuch verstanden werden sollte, Alevi-Wissen zu sammeln und zu vermitteln, sondern auch als eine potenzielle Kraft des Widerstands gegen Assimilationspolitiken. Die Teilnehmerinnen wiesen auf die Notwendigkeit hin, das Projekt durch Zusammenarbeit mit Alevi-Föderationen, Wissenschaftler*innen und den Medien zu stärken. Sie äußerten zudem ihre Überzeugung, dass dieses kollektive Unterfangen eine inklusive Wissensressource schaffen könne, die die vielfältigen Identitäten und Glaubensstrukturen des Alevitentums über verschiedene Geographien hinweg widerspiegelt, und versprachen sowohl materielle als auch moralische Unterstützung.
Das Symposium endete mit der Vorstellung des zukünftigen Fahrplans der Alevi-Enzyklopädie. Die Teilnehmer*innen betonten die Notwendigkeit, eine internationale Literatur über das Alevitentum aufzubauen, und hoben hervor, dass der mehrsprachige Ansatz der Enzyklopädie sowie ihre Fähigkeit, mehrere Perspektiven zu einem Thema darzustellen, sicherstellen würden, dass die interne Vielfalt des Alevitentums abgebildet wird.
Dem geplanten Zeitplan zufolge soll die Website Anfang 2025 online gehen, mit einem Aufruf an Wissenschaftler*innen und die Öffentlichkeit zur Beitragsleistung am 15. Januar 2025. Ab Juni 2025 sollen schriftliche Einträge auf die Seite hochgeladen werden, und die Enzyklopädie wird sich schrittweise nach einem strukturierten Plan weiterentwickeln.
Es wurde abschließend betont, dass die Alevi-Enzyklopädie nicht nur eine Wissensquelle ist, sondern auch ein Projekt, das die historische und kulturelle Realität des Alevitentums schützt, sein Erbe bewahrt, zu seiner Internationalisierung beiträgt und ein starkes Vermächtnis für die Zukunft hinterlässt.