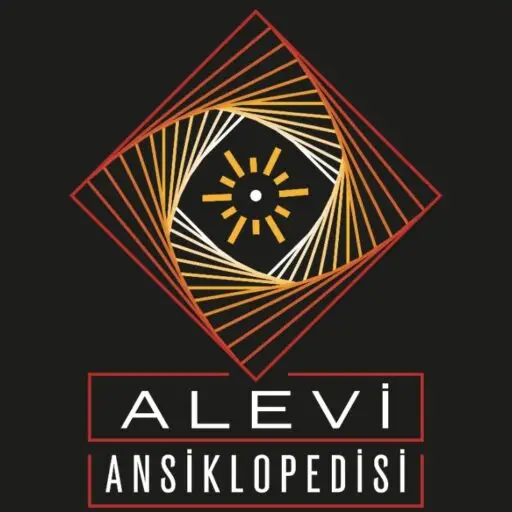Die Bewahrung des Alevitischen Gedächtnisses: Orte des Widerstands, kollektive Identität und kulturelle Kontinuität
Der Alevitismus ist ein Glaube und ein kulturelles Erbe mit tiefen Wurzeln. Er trägt eine reiche Geschichte und ein kollektives Gedächtnis, das universelle Werte wie Frieden, Gerechtigkeit und die Liebe zur Menschheit in den Vordergrund stellt. Doch im Laufe der Geschichte haben Alevis verschiedene Formen von Unterdrückung, Massakern und Diskriminierung erfahren. Diese Ereignisse haben tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der alevitischen Gemeinschaft hinterlassen und ihre Identität, ihren Glauben und ihre kulturelle Struktur geprägt. Trotz Völkermorden, Massakern, Zwangsumsiedlungen und Assimilationsversuchen hat sich das kollektive Gedächtnis des Alevitentums bis heute dank seiner tief verwurzelten und kraftvollen mündlichen Tradition erhalten.
Die Aleviten haben bedeutende Gedächtnisspeicher geschaffen, die die alevitische Identität von der Vergangenheit bis in die Gegenwart bewahrt, gespeichert und weitergegeben haben – als Widerstand gegen jahrhundertelange Politiken der Machthaber, die darauf abzielten, ihren Glauben, ihre Kultur und ihre Traditionen auszulöschen. Obwohl die politische Vorherrschaft in alevitischen Regionen oft in den Händen kolonialer Mächte lag, haben die Alevis ihre gelebten Erfahrungen und ihren Glauben in das Land selbst eingraviert – Traditionen in jeden Stein und jeden Boden eingeschrieben – und damit eine Form kultureller Souveränität etabliert. Trotz des Einsatzes aller repressiven Mechanismen durch koloniale Herrscher konnte diese kulturelle Dominanz nicht zerstört werden, und externe Mächte konnten ihre Präsenz in alevitischen Gebieten nicht über militärische Kontrolle hinaus etablieren.
Kollektive Kultur, soziales Leben, Glaube und mündliche Traditionen verwandeln einen bloßen geografischen Raum in ein lieu de mémoire – einen Erinnerungsort. Für Besatzer ist das Vorhandensein solcher Erinnerungsorte eines der größten Hindernisse für die Errichtung von Hegemonie. Weil sie Glauben und Tradition bewahren, fungieren Erinnerungsorte als selbsttragende Widerstandsmechanismen: Sie erinnern die Gemeinschaften an ihre Existenz trotz Massakern, Völkermorden und Vertreibungen und verhindern zugleich die Institutionalisierung fremder Herrschaft. Der französische Denker Pierre Nora beschrieb in seinem Werk Les Lieux de Mémoire Erinnerungsorte als Repräsentationen von Abwesenheit. Seiner Ansicht nach verkörpern solche Orte in Abwesenheit lebendiger Gedächtnisumgebungen die Vertretung derjenigen, die nicht mehr da sind. Sie sind lebendige Fragmente der Vergangenheit und stärken die Verbindung einer Gesellschaft zu ihrer Geschichte (1).
Die Erinnerungsorte des Alevitentums verweisen auf die gemeinsame Vergangenheit, den Glauben und das kulturelle Erbe der Gemeinschaft. Sie halten das kollektive Gedächtnis lebendig und fungieren als Teil der kollektiven Identität. So spielt beispielsweise die Region Dersim eine zentrale Rolle als alevitischer Erinnerungsort. Sie symbolisiert sowohl die Härten als auch den Widerstand, die die Alevis im Laufe ihrer Geschichte erfahren haben. Dersim enthält in diesem Sinne sowohl die schmerzhaften Erinnerungen der Vergangenheit als auch die Symbole des Widerstands. Solche Orte spielen eine wesentliche kulturelle und soziale Rolle. Die Bindung an diese Orte verstärkt das Gefühl der Zugehörigkeit zu Kultur und Gemeinschaft. Deshalb sind Gemeinschaften oft nicht nur durch ihr Leben und ihren Glauben, sondern auch durch ihre Erinnerungsorte Ziel von Angriffen.
Viele Faktoren tragen zu unserer Bindung an einen Ort bei, doch im Kern liegt das menschliche Bedürfnis, Sinn zu finden, Zugehörigkeit zu empfinden und Erinnerungen lebendig zu halten. Durch die Bindung an bestimmte Orte erinnern, teilen und deuten Menschen die mit ihnen verbundenen Erfahrungen und Erinnerungen neu.
Die Verbindung zwischen Pierre Noras Konzept der Erinnerungsorte und den alevitischen Gedächtnisorten ist entscheidend, um die Beziehung der alevitischen Gemeinschaft zur Geschichte zu verstehen und kollektive Gedächtnisstudien durchzuführen. Diese Gedächtnisorte bewahren die Vergangenheit, die Kultur und den Glauben der Gemeinschaft und gewährleisten ihre Weitergabe an künftige Generationen. Sie stärken die kollektive Identität und fördern die gesellschaftliche Solidarität. Nach Maurice Halbwachs, der betonte, dass soziale Räume und Denkmäler das kollektive Gedächtnis prägen und individuelle Erinnerungsprozesse beeinflussen, wird individuelles Gedächtnis immer innerhalb sozialer und kultureller Rahmen gebildet, die bestimmen, was erinnert wird.
Aus der Perspektive von Halbwachs’ Werk Die sozialen Rahmen des Gedächtnisses werden die Erinnerungen von Individuen innerhalb der Identität und Zugehörigkeit der Gesellschaft geformt, der sie angehören. Der Alevitismus als sozialer Rahmen prägt die Identität und das Zugehörigkeitsgefühl der Alevis. Die alevitische Gemeinschaft ist durch gemeinsame Glaubensvorstellungen, Traditionen und kulturelle Praktiken vereint. Dieser gemeinsame Rahmen beeinflusst die individuellen Erinnerungsprozesse und bildet das kollektive Gedächtnis (2).
Jan Assmann beschreibt in seinem Werk über kulturelles Gedächtnis Gesellschaften als funktionierend mit einem dualen Gedächtnissystem: persönliches Gedächtnis (individuelle Erfahrungen und Erinnerungen) und kulturelles Gedächtnis (gemeinsame Erfahrungen und kollektive Geschichte einer Gesellschaft) (3). Die alevitische Kultur und Erinnerung können in diesem dualen Rahmen verstanden werden, in dem individuelle Erfahrungen mit den kollektiven Erfahrungen der Gemeinschaft interagieren.
Die Verfolgungen und Völkermorde, denen die Alevis im Laufe der Geschichte ausgesetzt waren, haben nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern auch das kollektive Gedächtnis der Gemeinschaft geprägt. Francesca Cappelletto untersucht in ihrer Studie Long-Term Memory of Extreme Events: From Autobiography to History, wie solche traumatischen Ereignisse persönliche Erinnerungen und Autobiografien in Elemente des kollektiven Gedächtnisses verwandeln. Betrachtet man die alevitische Erfahrung durch diese Linse, wird deutlich, wie Zwangsumsiedlung, Assimilation, Krieg und Völkermord eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Weitergabe des kollektiven Gedächtnisses gespielt haben. Diese Erfahrungen ermöglichen es der Gemeinschaft, ihre Vergangenheit zu erinnern, zu deuten und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Cappelletto hebt hervor, dass Erinnerung ständig konstruiert und rekonstruiert wird (4). In diesem Sinne sind die Autobiografien und Zeugnisse von Alevis, die Krieg und Völkermord erlebt haben, nicht nur Teil des kollektiven Erinnerns, sondern auch entscheidende Elemente für dessen kontinuierliche Rekonstruktion und Stärkung.
Orte des Widerstands und der Erinnerung
Erinnerungsorte speichern das kollektive Leiden einer Gemeinschaft, erinnern zukünftige Generationen an diese Erfahrungen und sichern deren Weitergabe. Für Alevis sind solche Orte nicht nur Räume des Gedenkens, sondern auch Symbole des Widerstands gegen vergangene Gräueltaten. So bewahrt beispielsweise das Madımak-Hotel, obwohl es kein Museum ist, durch seinen inhärenten Charakter als Erinnerungsort die Widerstandstradition der alevitischen Gemeinschaft lebendig. Für Alevis sind Orte nicht bloß physische Strukturen, sondern auch symbolische Ausdrucksformen ihres Glaubens und ihres kulturellen Erbes, die im Gedächtnis monumentalisiert sind.
Physische Trennung und Erinnerung
Physische Trennung entsteht, wenn eine Gemeinschaft einen Ort verlässt – oder gezwungen wird, ihn zu verlassen. In solchen Fällen kann die Bindung an diesen Ort noch stärker werden. Physische Trennung führt oft dazu, dass dem Ort und den dort gemachten Erfahrungen mehr Bedeutung beigemessen wird, wodurch das Erinnern zunehmend an Gewicht gewinnt. Zudem kann das unmöglich gewordene direkte Zurückkehren den Wunsch verstärken, den Ort und die dortigen Erlebnisse zu erinnern und neu zu imaginieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründe für die Bindung an einen Ort Zugehörigkeit, Erinnerungen, Glauben, Identität und kulturelle Verbindungen umfassen. Solche Bindungen sind wesentlich, damit Menschen sich selbst verstehen, ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln und Erinnerungen lebendig halten können. Physische Trennung löst diese Bindungen nicht auf, sondern verstärkt sie und erhöht die Bedeutung des Erinnerns an den Ort. Die Bewahrung der räumlichen Bindungen des alevitischen Gedächtnisses ist entscheidend, um dieses Erbe zu schützen und an kommende Generationen weiterzugeben. Dafür bedarf es einer Kombination aus traditionellen und modernen Mitteln. Besonders für vertriebene oder exilierte Alevis – und ihre jüngeren Generationen – ist die Aufrechterhaltung der räumlichen Gedächtnisbindungen von großer Bedeutung. Durch physische wie digitale Mittel, durch traditionelle und moderne Methoden, kann dieses Gedächtnis bewahrt und an neue Generationen weitergegeben werden. Die aktive Teilnahme der Gemeinschaft sowie der effektive Einsatz von Technologie spielen dabei eine wichtige Rolle, um das Gedächtnis lebendig zu halten und erfolgreich in die Zukunft zu übertragen.
Die Alevi-Enzyklopädie hat sich genau dieser historischen Mission verschrieben: die Gedächtnisquellen des Alevitentums zu bewahren, die Identität, Geschichte, den Glauben und die kulturellen Werte der Gemeinschaft zu schützen und deren Weitergabe an künftige Generationen mithilfe digitaler Werkzeuge zu unterstützen.
Literatur
Assmann, J. (2018). Kulturelles Gedächtnis. Istanbul: Ayrıntı Yayınları.
Cappelletto, F. “Long-Term Memory of Extreme Events: From Autobiography to History.”
Halbwachs, M. (2016). Die sozialen Rahmen des Gedächtnisses. Ankara: Heretik Yayınları.
Nora, P. (2006). Les Lieux de Mémoire. Ankara: Dost Kitabevi.